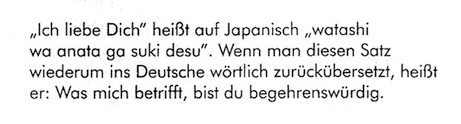Die Flüchtlinge in der Wiener Votivkirche haben ihren Hungerstreik beendet. Die zivilgesellschaftliche Grundsatzdebatte, die sie damit entfacht haben, steht erst an ihrem Anfang…
*
Das verstörendste Wort, das in den Wintermonaten durch die Stadt und die Medien geisterte, lautete
Hungerstreik. Nichts schien weniger in das trotz vielfältiger Krisenerscheinungen vor Wohlstand strotzende Wien zu passen als ein Hungerstreik.
Der Hungerstreik übersteigt den Erfahrungshorizont der Bevölkerung. Auf demonstrative Verweigerung der Nahrungsaufnahme war hier in den letzten Jahrzehnten niemand angewiesen. Der Grad an Verzweiflung, der dieser „besonderen Form des passiven Widerstands, die den eigenen Organismus als Argument einsetzt“ vorausgeht, erscheint von hier aus kaum nachvollziehbar. Ein drastischeres Verfahren des Protests kann es nicht geben.
Für einen großen Teil der Öffentlichkeit bedeutete der Flüchtlingsprotest doppeltes Befremden: Schon die Gestalt des Flüchtlings wird im tendenziell xenophoben Österreich als unangenehmes Hereinbrechen von Wirklichkeit in fragile Idyllen erfahren; der Flüchtling im Hungerstreik vervielfacht das Unbehagen und setzt enorme Aggressionspotenziale frei…
*
Wie es zum Hungerstreik der Flüchtlinge in der Wiener Votivkirche kam, ist bekannt; eine detaillierte Chronik der Ereignisse findet sich auf den Webseiten des
RefugeeProtestCamps Vienna. Hier nur die Eckdaten:
Am 24. November 2012 brach eine Gruppe von Flüchtlingen zum 35 km langen Fußmarsch vom Flüchtlingslager Traiskirchen nach Wien auf. Es war ein feuchtkalter Sonntag, trotzdem trugen einige Leute nur Flipflops an nackten Füßen. Das Ziel der Manifestation war und ist es, auf die unerträgliche Situation der Asylsuchenden in Österreich aufmerksam zu machen.
Die wichtigsten der sechs von den Refugee-Aktivisten formulierten
Forderungen lauten: Grundversorgung für alle AsylwerberInnen, und zwar unabhängig von ihrem Rechtsstatus –
das Recht zu Überleben; freie Wahl des Aufenthaltsortes –
das Recht auf freie Bewegung; Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Bildungsinstitutionen –
das Recht tätig zu sein; frei atmen, sich bewegen, arbeiten dürfen, allzu vermessen erscheint das nicht.
In der Folge schlugen die Flüchtlinge im Sigmund-Freud-Park ein improvisiertes Zeltlager auf. Damit wurde in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ein Stück österreichischer, europäischer und globaler Realität sichtbar, die sich normalerweise nur in kurz aufblitzenden Schlagzeilen über brennende Asylheime, gesunkene Flüchtlingsboote oder überfüllte Anhaltezentren zu erkennen gibt.
Am 28. Dezember wurde das Camp
polizeilich geräumt. Sigmund Freud, dem der Park seinen Namen verdankt, hätte sowohl als Wissenschaftler als auch als persönlich Exilierter viel zur Flüchtlings-Thematik und zu den Emotionen, die sie in manchen Teilen der Bevölkerung auslöst, zu sagen gehabt; und er hätte wohl auch die
„Verhältnismäßigkeit“ der Räumung treffend analysiert.
Am 22. Dezember trat ein Teil der Refugee-Aktivisten in Hungerstreik. Zunächst waren fünfundzwanzig, später vierzig Männer beteiligt, einige von ihnen wurden in der Zwischenzeit gemäß
Dublin 2-Verordnung nach Ungarn abgeschoben oder befinden sich in Schubhaft. Nach einer zehntägigen Unterbrechung – die Flüchtlinge unternahmen einen weiteren Versuch, mit Regierungsvertretern ins Gespräch zu kommen, fanden aber kein Gehör – wurde er am 1. Februar wieder aufgenommen. Das schaurige Drama nahm seinen Lauf: zerbrechliche, rasch verfallende Menschenkörper gegen die behäbig vor sich hin mäandernden Abläufe in der österreichischen und europäischen Bürokratie…
*
Es erscheint paradox: Um auf den fehlenden Ort in der Gesellschaft, der die Flüchtlinge – zumindest temporär – angehören, hinzuweisen, mussten sie ihre Körper durch Nahrungsentzug tendenziell zum Verschwinden bringen. Um gehört zu werden, blieb ihnen nur der Weg des sukzessiven Verstummens.
Aber spiegelt sich nicht in diesem Paradox exakt die Ausgangslage der Flüchtlinge wider?
Wie lebt ein Mensch, der nicht wahr sein oder tätig werden darf? Wie soll oder kann jemand leben, der von jedem persönlichen Wollen und jeder gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen ist? Wie existiert, wer unbestreitbar Bestandteil gegenwärtiger sozialer Realität ist, aber zugleich zu bedingungsloser Nicht-Sichtbarkeit verurteilt ist? Und was ließe sich den Vertretern einer Bevölkerungsgruppe raten, die als passive Verschubmasse behandelt wird und als solche eher der Ding- als der Menschenwelt angehört?
Sofern man ,Nahrung‘ in einem weiteren Sinn auffasst und auch das Recht auf Arbeit, Bildung und freie Wahl des Aufenthaltsortes mit einschließt, ist sie den Flüchtlingen faktisch immer schon entzogen. Während alle Welt von Vernetzung spricht, sind sie immer schon aus dem Verkehr gezogen.
Insofern erwies sich auch der gut gemeinte Vorschlag der Kirche, die Flüchtlinge im Souterrain des leer stehenden Servitenklosters unterzubringen, als problematisch. Damit wären die Flüchtlinge neuerlich in der Versenkung verschwunden. Es ging und geht ihnen schon auch darum, die Existenzbedingungen dieser weitgehend rechtlosen und zukunftslosen Bevölkerungsgruppe einer breiten Öffentlichkeit zu Bewusstsein zu bringen.
*
Die hungerstreikenden Flüchtlinge in der Votivkirche sind nicht gekommen, um den ÖsterreicherInnen etwas wegzunehmen, sondern haben ihnen etwas mitgebracht: den aktuellen und Fleisch gewordenen Zustandsbericht über die Gesellschaft, in der wir alle leben. Vor allem aber haben sie eine zivilgesellschaftliche Grundsatzdebatte entfacht:
Gibt es ein (humanitäres) Gesetz vor den Gesetzen?
Gibt es eine andere Art der Beziehung zu Flüchtlingen als die im Zeichen gnadenloser Repression und populistischer Häme?
Gibt es eine zivilgesellschaftliche Vernunft, die zu verhindern weiß, dass sich eine Klasse ausgestoßener, überall unerwünschter, bedingungslos ausbeutbarer, letztlich vogelfreier Menschen in Österreich und Europa herausbildet? (…)
Diese Fragen brauchten von den Refugee-Aktivisten nicht explizit gestellt zu werden, sie waren gestellt, schlagartig, durch ihr bloßes Erscheinen auf der politischen Bühne.
Für die schlummernde Öffentlichkeit bedeutete es ein abruptes Erwachen und fortschreitende Polarisierung:
Auf der einen Seite der zahlenmäßig kleinere Teil, der bereit ist, trotz aller kulturellen Verschiedenheit die eigene Existenz mit jener der Refugees in Relation zu setzen; auf der anderen Seite der zahlenmäßig größere Teil, der sich – worin eigentlich? – gestört fühlt und sich immer schon in einer besseren, gesicherteren, übergeordneten oder höherrangigen Position wähnt. (Freilich gibt es auch noch den zahlenmäßig größten, dritten Teil: jene Menschen, die bislang wenig Notiz von der Migrationsproblematik genommen oder sich nicht dazu geäußert haben.)
Zum zahlenmäßig kleineren Teil gehören u. a. die UnterstützerInnen, die den Refugees mit wintertauglicher Kleidung aushalfen, sie mit blitzartig organisierten Sprachkursen unterstützten oder die Ereignisse rund um den Protest auf hohem technischen und fachlichen Niveau in Wort und Bild dokumentierten; dazu gehören AutorInnen und KünstlerInnen wie
Susanne Scholl, Jean Ziegler,
Peter Waterhouse, Paul Poet oder
Marina Grzinic, die mehrere Tage und Nächte in der Votivkirche verbrachten und Gespräche mit den Flüchtlingen führten; dazu gehören WissenschaftlerInnen wie z. B. die Wiener Politikwissenschafterin
Sieglinde Rosenberger, die das österreichische Asylwesen über mehrere Jahre beobachtet und analysiert hat und es zusammenfassend als „strukturelle Desintegration“ charakterisiert; dazu gehört das international renommierte
Ludwig Boltzmann-Institut für Menschenrechte, das die gängige Definition des Flüchtlings laut Genfer Konvention relativiert, insofern diese im Kontext der Nachkriegszeit entstand und dringend den heutigen Verhältnissen angepasst werden müsste; dazu gehören zwei etablierte politische Parteien, die die Forderungen der Flüchtlinge zumindest teilweise aufgegriffen haben; nicht zuletzt gehören tausende Menschen dazu, die an österreichischen oder internationalen Solidaritätskundgebungen teilnahmen und weiterhin daran teilnehmen werden.
Zu dem anderen, zahlenmäßig größeren Teil, der willentlicher Ignoranz und Zynismus gern freien Lauf lässt, gehörten u. a. die
Früchtchen des Zorns, die vor einigen Wochen zur
„Besetzung der Besetzung“ aufgerufen haben: Neun junge Recken hatten versucht, eine Eskalation in der Kirche zu provozieren, kapitulierten aber vor der stillen Autorität der hungerstreikenden Flüchtlinge. Wer unvermittelt Menschen wie Shajahan Khan, Muhammed Numan, Jahangir Mir oder
Adalat Kahn von Angesicht zu Angesicht gegenüber tritt, verstummt leicht vor der Ausdruckskraft der durch Flucht- und Leidenserfahrung gezeichneten Gesichter: „Einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten zu werden.“ (
Emmanuel Lévinas), dies scheint für die Refugees in besonderem Maß zu gelten; zu dieser Gruppe gehören weiter die Verfasser der unzähligen menschenverachtenden Postings, die täglich in die Online-Ausgaben der österreichischen Tageszeitungen gepumpt werden und die zusammengenommen diese bedrohliche Sprechblase ergeben, die derzeit über der Wiener Votivkirche hängt und sie manchmal fast zu erdrücken scheint; nicht zuletzt gehören PolitikerInnen verschiedenster Färbung dazu, die im so genannten Superwahljahr mehr noch als sonst dem Populismus frönen und lieber dem tausendfach Gehörten folgen als dem Unerhörten oder leicht Überhörbaren.
*
Am 18. Februar beendeten die Refugees den Hungerstreik. Dazu hat nicht zuletzt der
Antwortbrief des Bundespräsidenten an die Flüchtlinge beigetragen, in dem er ihnen zwar keinerlei Hoffnung oder Zugeständnisse im Bezug auf ihre Forderungen machen konnte, der Manifestation aber große Anerkennung zollte: „Denn Menschen, die all das auf sich nehmen, was Sie und die von Ihnen erwähnten Personen auf sich nehmen, verdienen es, ernst genommen zu werden.“
Nach dem Hungerstreik hat sich die Lage verschärft. Die Gegend um die Wiener Votivkirche ist jetzt ein Jagdgebiet, die Flüchtlinge bewegen sich darin wie gehetzte Tiere. Sowie einer die Kirche verlässt, wird er polizeilich überprüft.
Am 28. Februar wurde Shajahan Khan, einer der Sprecher des Flüchtlingsprotests, verhaftet. Beim Verlassen der Kirche wurde er von Zivilbeamte an Armen und Schultern gepackt, ein paar Meter weit getragen und fixiert, bis er von Uniformierten umringt war und in Schubhaft gebracht wurde. Ihm droht die sofortige Rückführung nach Pakistan, dort möglicherweise der Tod.
Der zahlenmäßig größere Teil der Öffentlichkeit registrierte die Festnahme mit Genugtuung und kommentierte sie voller Hohn und Spott:
Gesetz ist Gesetz, also Abflug!
Vertreter des zahlenmäßig kleineren, aber stetig wachsenden Teils waren glücklicherweise auch vor Ort – die Verhaftung wurde vom österreichischen Filmemacher Igor Hauzenberger gefilmt.
Gesetz ist Gesetz, das wissen und respektieren auch die Aktivisten der zivilgesellschaftlichen Bewegung, die durch den Hungerstreik in Gang gesetzt wurde. Aber sind Gesetze in Stein gemeiselte, sakrosankte Gegebenheiten? Und was ist Politik, wenn nicht die Kunst, auf veränderte gesellschaftliche Bedingungen adäquat zu reagieren und das Zusammenleben unterschiedlichster Menschen auf humane Weise zu regeln?
Im 21. Jahrhundert ist die
Human condition ohne Einbeziehung der
„Migrant condition“ (
Laura Waddington) weder denk- noch darstellbar. Und Globalisierung bedeutet nicht nur, dass man mittels Smartphone jeden beliebigen Ort auf der Welt anwählen kann, es bedeutet auch, dass der Ort, an dem man sich befindet, für andere anwählbar wird. Dieser Gegebenheit wird in den kommenden Jahren auf die eine oder andere Weise Rechnung zu tragen sein.
*
Auf die eine oder auf die andere Weise?
Was soll geschehen mit den Migranten der Zukunft? Soll man sie – zusammen mit Obdachlosen und anderen Stigmatisierten – vom Erdball katapultieren, wie es die Leserschaft der Boulevardzeitungen in ihren Kommentaren implizit nahelegt? Oder muss letztlich doch der schwierigere Weg eingeschlagen und eine für alle Beteiligten lebbare Lösung gesucht werden.
Gehen wir von der Annahme aus, dass die rettende Lösung bereits vorliegt und nur mehr angewandt bzw. exekutiert werden muss, oder machen wir uns die Mühe der gegenteiligen Annahme, wonach sie erst zu entwerfen, erfinden, neu zu erfinden wäre?
Dafür gebührt den Flüchtlingen aus der Votivkirche der größte Respekt und tiefste Dank: Dass sie unzähligen Menschen in Österreich die Augen und die Einsicht in die Notwendigkeit des zivilgesellschaftlichen Engagements geöffnet haben. Und dass sie einem grausamen Pragmatismus, der jede (In)Fragestellung kategorisch ablehnt und die Antworten immer schon zu kennen vorgibt, beispielhaft die Stirn bieten.
Allein dafür müsste ihnen Asyl gewährt werden!

P. S. vom 3. März 2013:
Die Flüchtlings-Aktivisten haben sich nun doch für den
Umzug in das von der Kirche zur Verfügung gestellte Ausweichquartier im Servitenkloster entschieden: „Mit dem Kloster, für das die Flüchtlinge von Kardinal Schönborn das Gastrecht erhielten, wurde ein neuer, offener und sicherer Ort für protestierenden Flüchtlinge gefunden. (…) Das Kloster wird sowohl private als auch öffentliche Räume bereitstellen, an denen auch Diskussionsrunden, Deutschkurse oder Kulturveranstaltungen stattfinden können.“
Fundsteller - 2. Mär, 07:03