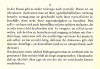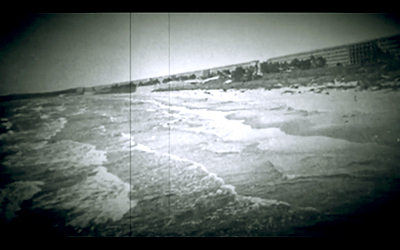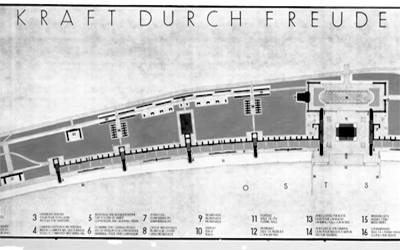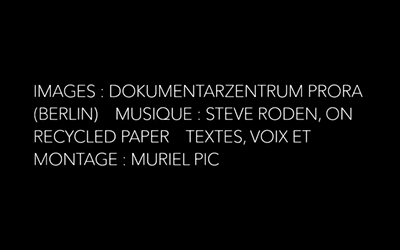...
den nüchternen Rausch der Poesie als Überlebensstrategie
Baudelaire hat Geburtstag, den hundertsiebenundneunzigsten, schönes Alter, ein paar Sätze weit will ich ihm gratulieren. Der Dichter hat mich, seit ich ihn das erste Mal gelesen habe, nie mehr ganz losgelassen. Er befand sich im Raum, auch in den heikleren Situationen, und er war dabei, wenn ich tagelang durch die Straßen einer Stadt gestreunt bin um mich nach dem definitiv Unauffindbaren umzusehen. Facebook und Google wissen Bescheid: Ich bin regelmäßiger Baudelaire-Nutzer.

Wie es zum ersten Baudelaire-Lesen gekommen ist? Daran kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Das initiale Ereignis muss unter den Ablagerungen nachfolgender Leseereignisse begraben worden sein. Ich erinnere mich nur an die grässlichen deutschen Übersetzungen, an diese in ratternde Reimschemata gezurrten Verse, zwangsgoetheisiert, mit einem übergestülpten Pathos versehen, das den Originalfassungen völlig fremd war. Friedhelm Kemp, den großen Übersetzer, kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, mit der französischen Sprache war ich erst am Anfang. Ich musste eine Lesemethode entwickelt haben, die störende Elemente ausfiltern und die Worte in ihren Rohzustand zurücksetzen konnte.

Zur selben Zeit kamen die Aufsätze von Walter Benjamin ins Haus. Darin erschien Baudelaire als Seismograph, der das unter den Oberflächen der großen Städte spürbare Brodeln gewittert, minutiös registriert, aus seiner Formlosigkeit erlöst und intuitiv auf künftige Jahrzehnte, Jahrhunderte hochrechnet hat.
„Baudelaire hat ein Buch geschrieben, das von vornherein wenig Aussicht auf Publikumserfolg gehabt hat. Er rechnete mit einem Lesertyp, wie ihn das [die Fleurs du mal; Anm.] einleitende Gedicht beschreibt. Und es hat sich ergeben, dass das eine weit blickende Berechnung gewesen ist. Der Leser, auf den er eingerichtet war, wurde ihm von der Folgezeit bereitgestellt.“ (Benjamin, 1939)

Baudelaire lesen: Ein Mensch in der Masse mit fast monströs geschärftem Blick. Unter tausend beiläufigen Blickkontakten ergeben sich welche, die einen plötzlichen Aufschwung auslösen oder direkt in Richtung Abgrund führen … Chocrezeption – dieses unentwegte Ausbalancieren, Mischen, Neudurchmischen und Weiterverarbeiten prekärer Sinneseindrücke. Die Kellergewölbe des wahrnehmende Subjekts führen direkt in die Kellergewölbe der mehr oder minder zivilisierten Gesellschaft. Manchmal ist von dort aus ein Stück Himmel zu sehen.

Jede einzelne Person aus der Masse stellt für sich genommen eine perzeptive Versuchsanordnung dar. Baudelaires Denken und sein vom Alltagsleben durchtränktes Schreiben haben, wie Yves Bonnefoy in seinem Buch Das Jahrhundert Baudelaires (La Siècle de Baudelaire, 2014) gezeigt hat, eine Revolution ausgelöst: enorme Ausweitung, neuartiges Fiebern im Gebrauch der Worte … jede Zeile drängt darauf, das Leben – nicht die Dichtkunst oder die Literatur – zu verändern.

Inzwischen blicken wir unter digitalen Bedingungen und durch neurowissenschaftliche Optiken auf solche zugleich individuellen und kollektiven Bebenwellen. Unsere Messungen tragen wir in Blogs oder die Schreibvorlagen sozialer Medien ein. Eines ist seit Baudelaire gleich geblieben: Aus dem Inneren der Erschütterung werden Sprache und Rhythmus generiert. Aus den Hohlräumen zwischen den dicht gedrängten Leibern am Bahnsteig dringen die Ausdünstungen, Gerüche, Geräusche des reizbaren Gesellschaftstiers. Im urbanen Durcheinander werden in jeder Sekunde unermessliche Potenziale von Aussagekräften freigesetzt. Man kann diese Erfahrungsschicht ignorieren oder als poetische, soziale Produktivkraft nutzen. Baudelaire hat es getan. Er musste vieles zugleich sein, um die seiner Epoche entsprechenden bildgebenden Verfahren hervorzubringen: Wahrnehmungs- und Stadtforscher, Kunstkenner und Kritiker, Zeichner und Musiker, Arzt und Patient, irrwitzig Liebender und haltlos Hassender, Abenteurer und Stubenhocker, alles in einem.

Mit den Jahren gesellten sich Marcel Proust, Paul Valéry, Gaston Bachelard, André Breton, Pierre Emmanuel, Henri Meschonnic, Florence Trocmé und gefühlte hundert weitere Namen dazu. Alles Leute, die auf je eigene Weise durch das Baudelaire'sche Werk hindurch agiert und produziert haben – das Netz oder der Vicious Circle. Dazu gehören auch Brigitte Fontaine, der kürzlich verstorbene Musiker Higelin oder Gerhard Fischer, später Mitbegründer der Gruppe Daedalus, der im September 1980 eine aufgelassene Wiener Bäckerei mit einer im besten Sinn befremdlichen Baudelaire-Installation bespielt hat. Sie alle berufen sich auf den simplen verbindenden Akt: eines seiner Bücher zur Hand nehmen, egal welches, schauen, ob der Funke überspringt und, wenn ja, an welcher Stelle, wie genau und wohin…
Die Auswahl ist groß. Zur Verfügung stehen nicht nur die Fleurs du mal, deren 'Böses', wie Georges Bataille in Die Literatur und das Böse mutmaßt, bereits in der Schreib-Disposition und Selbstermächtigung des Autors begründet ist, auch der Spleen von Paris (hier beispielsweise Das zweifache Zimmer oder Schießplatz und Friedhof), die Tagebücher (Journaux Intimes) und Briefe, das Strandgut (Les Épaves), die kleinen Prosa-Fragmente oder längeren Erzählungen, Fanfarlo, die Essays zur zeitgenössischen Kunst, die Poe-Übersetzungen oder auch, warum nicht, Die künstlichen Paradiese.

Übrigens kommen die darin erwähnten psychotropen Substanzen bei Baudelaire nicht sonderlich gut weg. Er durchlief die Laster – mit Haut und Haaren – und schüttelte sie überdrüssig ab. Um seiner Spur bis zum Letzten folgen zu können, musste er in jedem Moment sein schonungslosester Kritiker bleiben. Daher das Paradox: Der Baudelaire‘sche Rausch ist ein nüchterner Rausch. Rauschmittel würden diese fragile Übereinkunft von Konzentration und Zerstreuung, Aufschwung und Absturz nur stören. Er ist Teil einer Überlebensstrategie.

Wenige Jahre vor seinem Tod arbeitete Baudelaire an einem Vorwort für die dritte Auflage der Fleurs du mal – "in dem ich meine Tricks und meine Methode erklären und jeden die Kunst lehren werde, ein Gleiches zustande zu bringen" (Brief an Michel Lévy, 1862). Der "Sänger der wilden Lüste des Weines und des Opiums", sehnte sich vor allem nach Ruhe und nach einer Nacht ohne Ende:

Also lass mich das vorletzte Glas auf dich erheben, Baudelaire, du unendlich Getriebener und unwilliger Lehrmeister, auf dich und deine hundertsiebenundneunzig Jahr! Ach, wenn du heute bei uns wärest! Gendermäßig müssten wir dich freilich noch briefen. Lass mich dir einen Satz von Henri Meschonnic zurufen, den ich ohne dich nie kennengelernt hätte. Er hat übrigens eine merkwürdige Studie zum Rhythmus in deinem Herbstgesang, Chant d'automne, verfasst. Der Satz eröffnet den Essay Wie man lernt, nicht zu wissen, was man tut (2008):

„Es ist das Unbekannte, das uns führt, uns dominiert.
Es macht das Denken leidenschaftlich, denn nur durch unser Unbekanntes machen wir uns auf den Weg nach uns selbst.
Dieses Unbekannte in uns selbst und dieses Denken sind in derselben Suche begründet wie das Unbekannte des Subjekts, das Unbekannte des Gedichts, das Unbekannte der Kunst, das Unbekannte der Sprache, das Unbekannte der Ethik, das Unbekannte der Politik.
Das Unbekannte der Gesellschaft…“